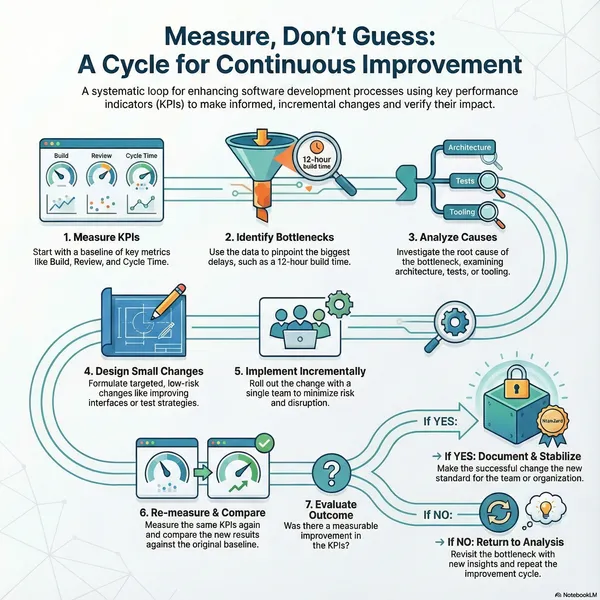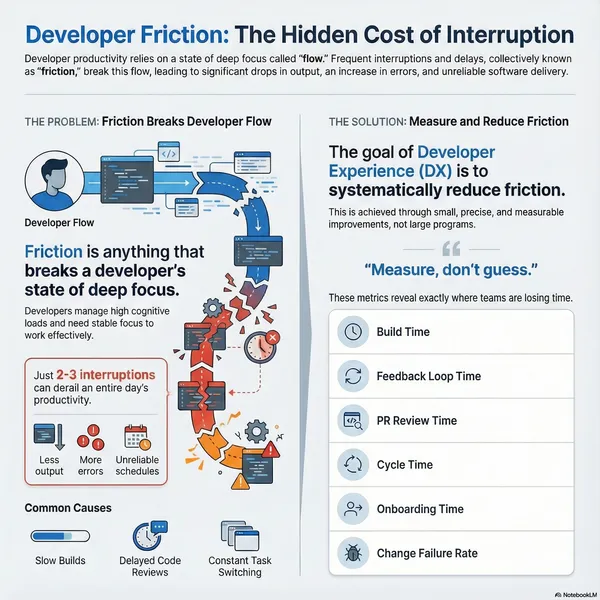Tutorials & Guides
Search Post
Recent Posts
DX Consulting in German and English
Ready to improve developer productivity?
Let’s discuss how I can help your team reduce friction, improve delivery performance, and establish a measurable, stable development workflow. All services are available in German and English.

000 +
Years of Experience